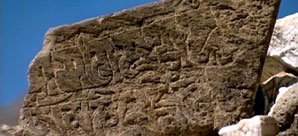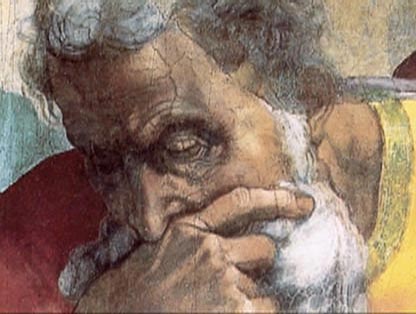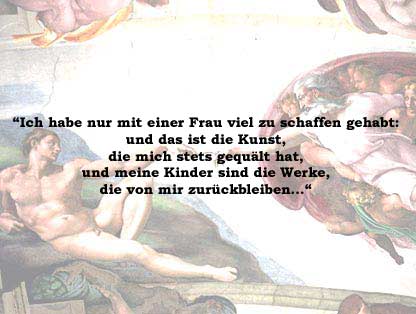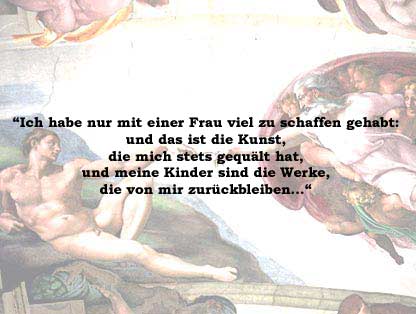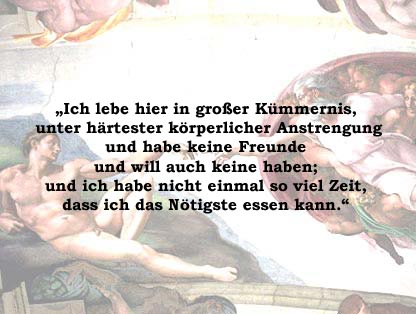Frau Holles Apfelgarten
Frau Holles Apfelgarten(Deutschland)
Es geschah einmal, dass im Garten der schönen Frau Holle die Apfelbäume nicht mehr gediehen. Unten auf der Erde lebte eine alte Frau, und deren Apfelbäume standen im Frühling in herrlicher Blüte. Wenn der Herbst kam, senkten sich die Äste voll reifer Früchte. Da sprach die schöne Frau Holle zu ihrem Liebsten, dem Junker Tod: "Reite hinab zur Erde und hole mir die Alte herauf. Sie hat nun lange genug auf der Erde gelebt, und es wird Zeit, dass sie zu uns zurückkehrt."
Der Junker Tod reitet hinab zur Erde, klopft bei der Alten an und spricht zu ihr: "Du hast nun so lange auf der Erde gelebt, und meine Liebste, die schöne Frau Holle, will dich um sich haben. In ihrem Garten gedeihen die Apfelbäume nicht mehr. Ich soll dich holen, damit du sie pflegst."
Die Alte hatte aber noch gar keine Lust, die Erde schon zu verlassen, und sie spricht zum Tod: "Ich habe auch eine Bitte: Lass uns noch einmal Karten spielen. Weißt du, am Kartenspiel habe ich immer meine Freude gehabt. Und wir machen es so: Gewinne ich, dann musst du mich hier lassen; gewinnst du, darfst du mich mitnehmen."
Der Tod ist einverstanden. Er denkt, die Alte besiege ich leicht im Kartenspiel. Er wusste aber nicht, dass das Haus der Alten an einer Heerstraße lag und die Alte immer mit den Landsknechten Karten gespielt hatte. Sie kannte alle Kniffe. Die Alte mischt die Karten und gewinnt. Der Junker Tod runzelt die Stirne und spricht: "Lass uns noch einmal spielen."
Dieses Mal mischt er die Karten. Aber wieder gewinnt die Alte, und der Junker Tod spricht: "Jetzt lass uns noch einmal spielen!" Die Alte erwidert: "Gut, aber mehr als drei Spiele werden nicht gespielt. Das ist der Brauch. Über die Zahl drei gehen wir nicht hinaus."
Also spielen sie das dritte Spiel. Wiederum gewinnt die Alte, und sie spricht zum Junker Tod: "Geh nur allein hinauf, was gehen mich die Apfelbäume deiner Liebsten an, mir gefällt es noch in meinem Garten und hier auf der Erde."
So reitet der Junker Tod traurig hinauf in den Garten der schönen Holle. Als er nun allein kommt, da zürnt sie mit ihm und spricht: "Du wirst so lange mein Lager nicht mit mir teilen, bis du mir die Alte heraufgebracht hast."
Es kamen aber gerade die zwölf Heiligen Nächte heran, und der Junker Tod wusste, dass in diesen Nächten jedem die Türe geöffnet werden musste, und sei es auch der größte Feind. Er setzt sich also auf sein Pferd und reitet wieder hinab zu der Alten und pocht an die Tür. Die Alte öffnet. Sie war nicht sehr erfreut, als sie den Tod schon wieder sah, aber was soll sie machen: Es sind die zwölf Nächte, und da muss jedem die Tür geöffnet werden.
Der Junker Tod spricht: "Du weißt, in diesen zwölf Nächten hat jeder einen Wunsch frei. Ich habe nun diesen Wunsch: Setze dich hinter mich auf mein Pferd, reite mit mir bis zur Gartenpforte meiner Liebsten und schau hinein. Ich verspreche dir, wenn du nicht dort bleiben willst, werde ich dich wieder zurückbringen."
Die Alte spricht: "Gut, ich kann dir diesen Wunsch nicht abschlagen. Aber du musst es mir schwören, und du weißt, ein Eid in den zwölf Nächten ist zwölffach wert."
Der Junker Tod schwört, dass er sie zur Erde zurückbringe, wenn es ihr nicht gefalle. Die Alte setzt sich hinter den Tod aufs Pferd, und sie reiten hinauf in den Paradiesgarten. Dort öffnet der Tod das Tor einen Spalt und spricht: "Schau einmal hinein." Die Alte schaut durch das Tor, und da sieht sie die schöne Holle, die hat eine Krone auf aus blanken Sternen, und sie ist umgeben von schönen jungen Mädchen. Aber die Apfelbäume, die sehen kläglich aus.
Da fragt der Junker Tod: "Nun, wie gefällt dir denn der Garten, wie gefällt dir meine Liebste?"
"Ja, sie gefällt mir schon, aber siehst du, sie ist umgeben von lauter jungen Frauen, und schau mich an, wie alt und runzlig ich bin; das wird ihr nicht gefallen."
Da spricht der Tod zu ihr: "Ja, weißt du denn nicht: Wenn meine Liebste dich berührt, dann wirst auch du wieder jung und schön."
"Ja", zürnt die Alte, "weshalb hast du mir das nicht gleich gesagt und lässt mich noch dreimal Karten spielen!" Und sie sprang hinein durch das Tor, die schöne Holle berührte sie, und da war die Alte wieder jung und schön. Dann machte sie sich an die Pflege der Apfelbäume, und seither gedeihen die Apfelbäume im Garten der Holle wunderbar.
(Erzählfassung von Linde Knoch. In: Rauhnächte. hrsg. von Sigrid Früh. Stendel. Waiblingen 1998)
"Mir gefällt es noch auf der Erde! Was gehen mich die Äpfelbäume der Frau Holle an!"
Ein heiteres, erheiterndes Märchen, mit alten Motiven in jungem Gewand. Die Frau Holle im Märchen der Brüder Grimm wird meist als liebenswertes Großmütterchen dargestellt, sowohl in Illustrationen als auch im Sprachton auf Kassetten für Kinder. Dabei wird vergessen, dass es von ihr heißt "sie hatte so große Zähne, und das Mädchen fürchtete sich vor ihr". Wenn wir ein rechtes Bild von der Hollegestalt bekommen wollen, gehört der Furcht erregende Aspekt dazu.
Das Wort Holle ist verwandt mit Hel, der Unterweltgöttin der Germanen, die Leben spendet und Leben zurück nimmt. Einerseits ist sie die "Holde" oder "Hulda", die mütterlich sorgende Göttin, die segnend über die Erde schreitet, den Flachsbau und das Spinnen hütet. Faulen Spinnerinnen verwirrt sie das Garn, fleißigen schenkt sie Spindeln. Bei Göttingen ließ man ein wenig Flachs auf dem Acker ungeschnitten "vor Frû Holle", und südöstlich von Kassel liegt ein Holleteich, von dem angenommen wurde, dass er der Eingang zum Reich der Frau Holle sei. Sie schickt die Seelen in Kindgestalt ins Leben und ruft sie andererseits als Alte wieder zu sich. Nach alter Überlieferung spinnt sie im Harz in den Rauhnächten, den heiligen zwölf Nächten, aus Flachs ein Netz und fängt als Todesgöttin mit ihm die, die im nächsten Jahr sterben sollen. (Paul Herrmann. Deutsche Mythologie. Hrsg. von Thomas Jung. Aufbau Verlag. Berlin 1994 S. 299 f.)
In unserem Märchen spiegelt sich vieles davon wider. Die Alte wird in den zwölf Rauhnächten geholt; die schöne Holle ist mit dem Junker Tod verbunden; sie gibt oder verjüngt das Leben und sie nimmt das Leben.
Die Apfelbäume der Frau Holle gedeihen nicht, das ist eine unfruchtbare Situation im Paradies – ein seltsames Bild. Im Grimm-Märchen muss das Mädchen auch dem Apfelbaum helfen, die Früchte müssen geerntet werden. Übernimmt ein Mensch, der "lange genug auf der Erde gelebt" hat, nun eine "himmlische" Aufgabe? Der Tod wird ausgeschickt, um die Alte für diesen Dienst zu holen. Sie mag noch nicht die Erde verlassen. Aus anderen Märchen kennen wir das Motiv der Unordnung, in die die Erde gerät, wenn der Tod durch eine List festgehalten wird und seine Aufgabe nicht erfüllen kann. Das Gleichgewicht ist dann gestört.
Auf heitere Art erzählt uns das Märchen, dass es wohl nicht darauf ankommt, ob wir noch Lust zum Leben haben, wenn wir im Jenseits "gebraucht" werden. Der Blick durch den Spalt der geöffneten Paradiespforte ist uns sicher auch nicht immer gewährt. So mag es sein, dass wir uns eine Weile töricht weigern, mit "nach oben" zu kommen, wo wir wieder "jung und schön" gemacht werden und durch die Berührung der Todes- und Lebensgöttin eine neue Aufgabe bekommen. Ein stärkendes Bild: Wer lange genug auf der Erde gelebt hat, kann vielleicht seinem Tod sinnvoll entgegen leben.